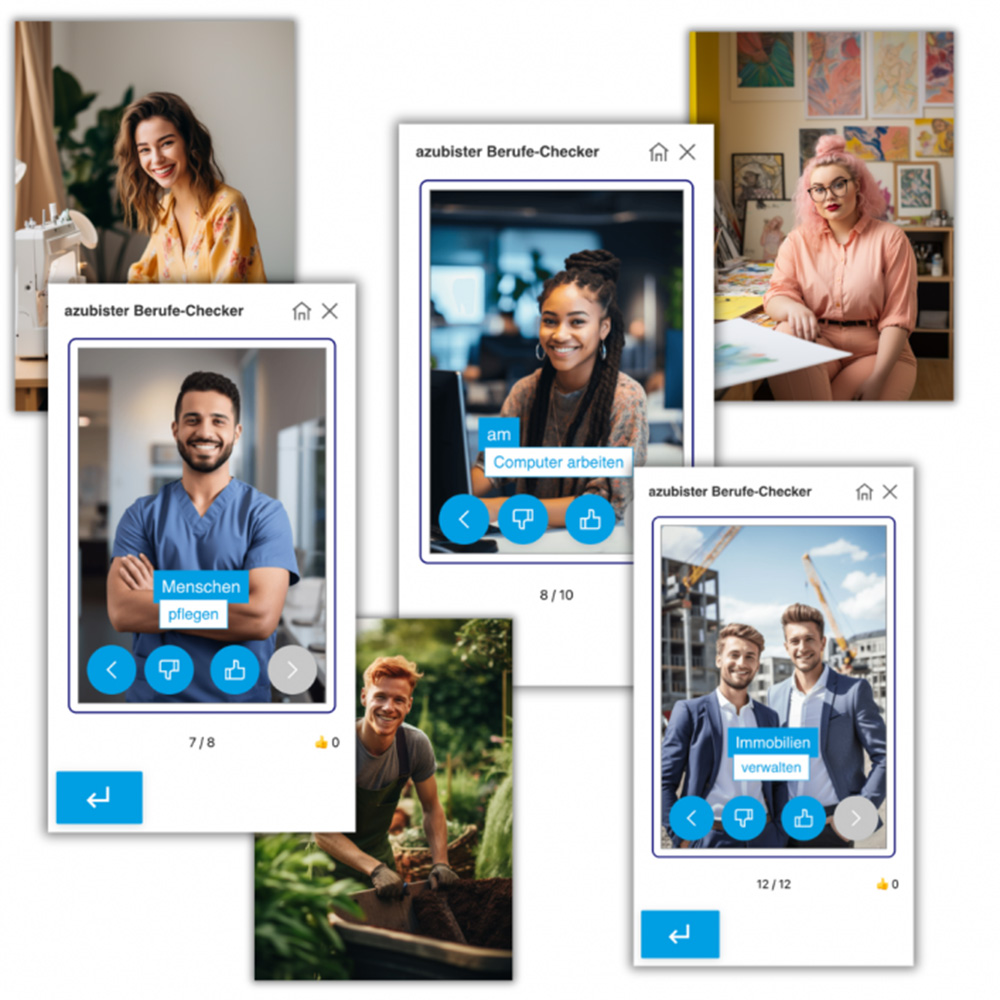Die Idee dahinter ist einfach und gut: Statt Geld für eine Dienstleistung zu bezahlen, biete ich eine andere Dienstleistung im Tausch an. Einfach ist der Aufbau solcher Tauschsysteme jedoch nicht. Wer mitmachen will, muss zwei wichtige Dinge mitbringen: Zeit und Ideen.
Das Schöne an der Währung, mit der sich die Menschen an der Limmat gegenseitig bezahlen, ist: Jeder besitzt sie, und zwar in größeren Mengen. Denn ein paar hundert Züricher rechnen nicht mehr allein in Schweizer Franken, sondern in Talenten. Und ein paar davon hat jeder, auch wenn er manchmal länger suchen muss, welches seiner Talente bei anderen gefragt ist.
Geld dagegen haben sie irgendwie nie genug, finden viele, die in der teuersten Stadt der Schweiz leben. Hier sind nicht nur die Mieten hoch, auch Lebensmittel oder Restaurantbesuche kosten viel und für gewisse Extras, die sich viele gerne mal gönnen würden, bleibt am Monatsende oft nicht viel übrig.
Dienstleistungen tauschen, statt mit Geld zu bezahlen
Das ist aber nur einer der Gründe, warum hier an der Limmat schon 200 Einwohner bei „Tauschen am Fluss“ mitmachen. In dem Tauschkreis bezahlen sich die Einwohner nicht mehr in Geld, sondern in Stunden und in Talenten.
Und das geht so: „Nach unserem letzten Feierabendtreff ging ein junger Mann mit einer Pensionistin nach Hause und stellte ihr den neuen Fernseher ein. Und eine Schülerin hat einen älteren Herren gefunden, der ihr jetzt Nachhilfeunterricht gibt“, erzählt Projektleiterin Ursula Marx. Die Rechnung ist dabei ganz einfach: Wer einen Dienst für einen anderen verrichtet, also sein Talent eine Stunde lang für andere einsetzt, der bekommt dafür eine Stunde Zeit gutgeschrieben.
Dieses Zeitguthaben kann er dann bei einem anderem wieder einlösen – er kann also eine Stunde lang ein fremdes Talent für sich arbeiten lassen. Ob er nun jemanden sucht, der für ihn kocht und backt, eine Mütze strickt, einen Tisch repariert oder als Babysitter einspringt – es gibt fast keine Arbeit, die nicht einer der 200 Mittauscher am Fluss anbieten würde.
Eine Züricherin hat sich gerade ihren 40. Geburtstag komplett über den Tauschring „finanziert“: Sie engagierte eine Band für die Tanzmusik, eine Köchin fürs Catering, einen Barmann und Helfer für den Zeltaufbau und die Gästebewirtung. Insgesamt hat sie 30 Minusstunden angesammelt. Zeit, die sie nun selber für andere einsetzen wird. In der Tauschdatenbank hat sie schon inseriert, welche Talente sie anbieten kann.
Zeit ist Geld – das gilt hier wörtlich
Worüber Ursula Marx immer wieder staunt: „Bei uns finden immer wieder Leute zueinander, die sich sonst nie gefunden hätten.“ Unter den 200 Tauschenden vom Limmatquartier sind alle Altersklassen vertreten, und vom Studenten in abgewetzten Jeans bis zum Direktor in Designeranzug sitzen auch alle Einkommensklassen beim Feierabendtreff zusammen.
Eines haben aber alle gemeinsam, sagt die Projektleiterin: Wer mittauschen will, muss experimentierfreudig sein und zur Not auch mal einen Dienst verrichten, den er nicht unbedingt angeboten hätte, wenn nicht gerade Not am Mann gewesen wäre. Denn keines der Mitglieder kann nur andere für sich arbeiten lassen und ewig warten, bis sein eigenes Talent angefordert wird. Manchmal muss man sich schon etwas einfallen lassen und eben auch mal beim anderen Rasen mähen, Fenster putzen oder beim nächsten Quartierfest die Theke schmeißen, um die angehäuften Minusstunden wieder abzubauen.
Das beliebteste angenommene Talent seien übrigens Massagen, sagt Marx, „fast jeder, der eine Stunde angehäuft hat, gönnt sich mal eine.“
Das Tauschsystem stärkt den sozialen Zusammenhalt
Was sich zwischen den Tauschenden entwickelt, ist so etwas wie ein Nachbarschaftsgefühl, selbst in einer Großstadt wie Zürich, dies hat Ursula Marx selbst erlebt: „Ich lebe seit 15 Jahren im Quartier und habe vorher nie jemanden gegrüßt. Jetzt gehe ich hier in die Migros, unseren Supermarkt, und kenne plötzlich drei Leute.“
Das bestätigen auch diejenigen, die viele solcher Tauschsysteme auswerten wie Heidi Lehner von der Sunflower Foundation. Die Stiftung unterstützt Projekte, bei denen sich Menschen einmal auf andere Art mit dem Thema Geld auseinandersetzen, ob mit Regionalwährungen, Zeitkonten oder eben Tauschsystemen.
Heidi Lehner hat festgestellt: Die Tauschsysteme sind gelebte Nachbarschaftshilfe, ganz wie früher, als das Leben noch dörflicher war und übersichtlicher. Und als sich die Menschen, die nebeneinander wohnten, noch kannten. Inzwischen gibt es Unmengen von Tauschkreisen, die meist kleinräumig organisiert sind. Allein fünf in Zürich, gut 30 in der Schweiz, 46 in Baden-Württemberg und mehrere hundert in Deutschland.
Alternativ zahlen mit Komplementär-Währungen
Daneben gibt es vielerorts Komplementärwährungs-Bewegungen, die experimentieren, auf welchen Wegen man noch Dinge und Dienste handeln kann. Als Geldersatz nehmen sie Gutscheine an, tauschen Gegenstände oder akzeptieren Regionalgeld.
Chiemgauer (Scan) etwa sind für 2.700 Bürger rund um Rosenheim ganz selbstverständlich, damit ist der Chiemgauer das größte Regionalgeldsystem hierzulande. Er funktioniert wie ein Gutschein, den man für Euro kaufen kann, aber sehr schnell wieder ausgeben muss, weil er mit der Zeit seinen Wert verliert. So heizt das „Schwundgeld“, wie Fachleute das nennen, den Handel in der Region an.
Auch der Bremer Roland und der LechTaler im Großraum Augsburg funktionieren nach diesem Prinzip und sie laufen gut, weil die Händler und Produzenten in der Region ein dichtes Netzwerk gesponnen haben, an denen man das Regiogeld wieder los wird. Andernorts wollten die Organisatoren eher die brachliegenden Fähigkeiten der Bürger und Handwerker fördern. So ist der Talentetausch in Vorarlberg entstanden, bei dem inzwischen 1.800 Personen und Firmen in mehreren österreichischen Bundesländern rege mitmachen und der ein Vorbild für viele Zeit-Tauschkreise war.
Nicht bei allen Systemen geht es aber darum, das erworbene Guthaben schnell wieder einzutauschen. Bei den Altersgenossenschaften von Baden-Württemberg ging es ums Horten. Wer ältere Menschen betreut und dadurch eine Gutschrift erwirbt, der kann sie im Alter einlösen, wenn er selber Hilfe braucht – das war die Idee, auch wenn sie nicht wirklich gut funktionierte.
Und schließlich gibt es auch Gruppen, die Kreditgeld ausgeben. Das bekannteste Beispiel solcher Kreditgenossenschaften ist die Schweizer WIR-Bank, bei der sich gut 60.000 Mitglieder und Firmen schon seit 1934 gegenseitig Wir-Franken leihen oder untereinander „gschäften“. Sie ist eines der ältesten und auch das weltweit größte Komplementärwährungssystem.
Wie sind alternative Zahlungsmethoden entstanden?
Die meisten dieser Gruppen haben sich in den 90er Jahren gegründet. Da kam zum ersten Mal die Idee auf: Man müsste Organisationen schaffen, in denen sich Menschen wieder gegenseitig zur Hand gehen, auch ohne Geld. Eine zweite Gründungswelle schwappte kurz nach der Jahrtausendwende über die Länder, in den Krisenjahren nach dem Platzen der New-Economy-Blase.
Damals wollten viele nicht nur zu Old Economy zurück, sondern auch zur guten alten Idee, dass man eine Wirtschaft nicht nur mit Geld aufrechterhalten kann, sondern auch mit Menschen, die zusammenhalten. In spektakulären Fällen hat das sogar funktioniert: Als Argentinien in den Staatsbankrott schlitterte, hielten die Einwohner das Land mit Tauschsystemen am Laufen. In Japan kann man sich landesweit Pflegestunden zusammensparen und so die Versorgung im Alter sichern.
Nachbarschaftshilfe war seit je her in Krisenzeiten gefragt. Ökonomen, die Tauschsysteme analysiert haben, sagen sogar, dass sich dadurch die Kluft zwischen Arm und Reich verringern lasse, wenn nicht mehr in Geld bezahlt wird, sondern in der Einheit Zeit. Denn vor der Zeituhr sind alle gleich und viele können sich leisten, wofür sie sonst kein Geld hätten.
Die dritte große Welle erleben die Tauschsysteme jetzt: Es gründen sich zwar wenige neue, aber noch nie hätten die bestehenden Kreise einen solchen Zulauf an neuen Mitgliedern erfahren, sagt Marktbeobachterin Heidi Lehner, und noch nie sei das Echo so groß gewesen wie derzeit. Vor allzu hehren Erwartungen warnt sie aber: „Es wurden schon oft zu große Erwartungen in solche Systeme gesetzt. Die Wunschvorstellung war, dass Leute, die aus dem Wirtschaftssystem herausfallen, etwa durch Arbeitslosigkeit, damit ein Auskommen haben.“
Wie gut funktionieren Tauschsysteme?
Aber Fakt ist: Allein durch das Zeit-Tauschen kann keiner seinen Lebensunterhalt bestreiten. Denn für Miete, Altersvorsorge oder Krankenkasse braucht er trotzdem Geld und zwar nicht zu knapp. Auch wenn jemand aus dem Tauschkreis austreten will oder wenn er schwer krank wird, bevor er seine Minusstunden abgeleistet hat, nehmen die Systeme ihm dafür ausnahmsweise mal Geld ab.
Was die Tauschsysteme aber bewirken, sagen Studien: Sie liefern eine soziale Rendite. Viele Tauschende genießen das Gefühl, gebraucht zu werden. Für manche ist es ein großer Wert, plötzlich Talente an sich zu entdecken, die sie noch nicht kannten.
Bei manchen dauert es zwar Jahre, weiß die Züricherin Ursula Marx, aber wenn sie dann merken, dass sie besonders gute Nachhilfelehrer sind oder als Alleinunterhalter ganze Partygruppen zum Lachen bringen, dann lasse sich das nicht mit Geld aufwiegen. Genau das aber ist auch der heikelste Punkt: Die Frage, wie viel ist ein Talent wert?
Sie treibt die Tauschkreise immer wieder um, sagt Beobachterin Heidi Lehner. Über nichts wird in den Gruppen so viel diskutiert und bisweilen gestritten wie darüber, ob es wirklich gerecht sei, dass eine Stunde Brotbacken genauso wertvoll sei wie eine Stunde Hilfe bei der Steuererklärung oder Englischunterricht. Denn im Privatbereich wird nicht unterschieden, ob jemand eine teure Ausbildung gemacht hat, um eine Tätigkeit ausüben zu können oder nicht.
Manche Tauschenden zweifeln irgendwann, ob sie für ihr Talent oder ihr Wissen nicht viel besser entlohnt würden, wenn sie es für Geld auf dem Arbeitsmarkt anbieten würden und treten wieder aus den Freiwilligenkreisen aus.
Die Gerechtigkeitsfrage ist der Punkt, an dem viele Tauschringe scheitern. „Wir brauchen ein neues Verständnis von Gerechtigkeit dafür“, findet Beobachterin Heidi Lehner, „und die Tauschpartner müssen sich immer wieder damit auseinandersetzen, was ihnen die Dinge wert sind. Weil kein Ding mehr einen festen Preis hat und man um Gegenwerte verhandeln muss.“ Von einem sollten sich die Mitmachenden deshalb gleich verabschieden, warnt sie: Ein Tauschsystem ist kein Kuschelclub. „Er ist knallharte Marktwirtschaft. Und es braucht viel soziale Kompetenz um da mitzumachen und immer wieder den Wert seiner Talente auszuhandeln.“
Wann funktioniert das Tauschen – und wann nicht?
Wovon es letztlich abhängt, ob ein Tauschsystem bestens läuft wie in Zürich oder in Vorarlberg beim „Talente tauschen“, ist selbst denen, die sie leiten und untersuchen nicht ganz klar. Sie hoffen darauf, dass Wissenschaftler bald erforschen, wie die Ökonomien ohne Geld am besten funktionieren.
Denn es hängt nur bedingt von der Mitgliederzahl ab. Es braucht zwar eine gewisse kritische Menge, damit jeder, der etwas anbietet auch eine Gegenleistung findet, die er braucht. Umgekehrt ist aber selbst bei 300 Tauschenden nicht gesagt, dass der Laden läuft. Manche erleben sogar, dass es schwieriger wird, wenn die Mitgliedergröße eine bestimmte Marke knackt.
Denn eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Markt ist Vertrauen. Je besser sich die Tauschenden untereinander kennen, desto eher helfen sie sich und lassen den anderen in die eigene Wohnung. Trotzdem kann, wie das Beispiel von Vorarlberg zeigt, ein Tauschsystem sogar mehrere österreichische Bundesländer vernetzen und auch deren Unternehmen.
Außerdem braucht es Organisatoren, die solche Tauschkreise möglichst professionell aufziehen und die Zeitguthaben akribisch verwalten. Doch Professionalität alleine hilft auch nicht. Das mussten die Kreise erfahren, bei denen Organisationen wie das Rote Kreuz oder Seniorenbetreuer einstiegen, als die Gründer müde wurden. Und die danach prompt erlahmten.
Es ist also wohl auch das Herzblut der Organisatoren, das zählt. Und natürlich eine Portion Geduld, denn etwa 15 Jahre brauchen solche Kreise schon, bis sie wirklich zu Selbstläufern werden, beobachtet Heidi Lehner.
Was die Kreise dafür langfristig erreichen können, hat der Anthropologe Heinzpeter Znoj so beschrieben: Sie verändern die Beziehungen der Menschen untereinander. Wenn wir nämlich mit Geld bezahlen, haben wir das Gefühl, damit alles abgegolten zu haben. Wir liquidieren und sind quitt. Und bleiben wir jemandem Geld schuldig, drückt uns ein negatives Gefühl.
Bezahlen wir dagegen in Zeit und Talent, dann liquidieren wir nicht sofort. Es dauert es eine Weile, bis sich die Rechnung ausgleicht. Dadurch, sagt Znoj, entsteht bei uns langfristig ein gutes Gefühl: Wir sind aufeinander angewiesen und wissen, wir bekommen die Hilfe, die wir geben, irgendwann zurück.