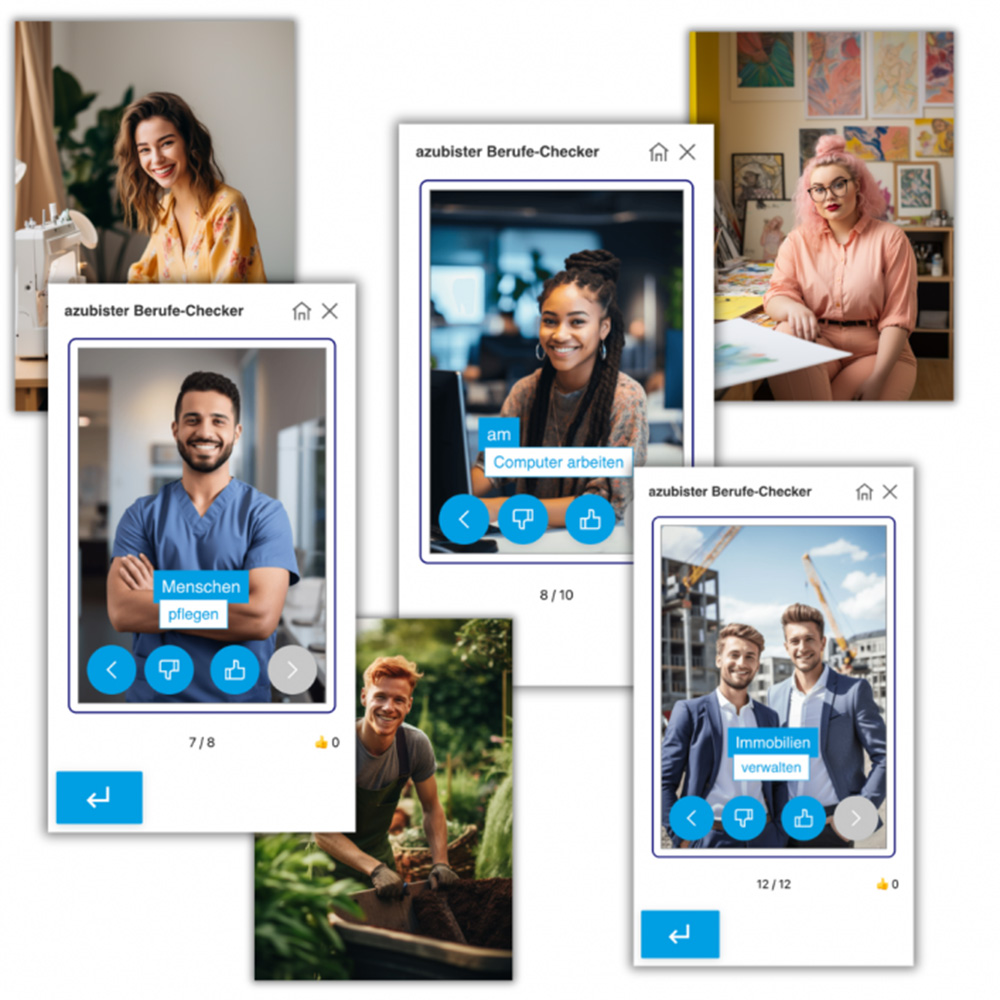Über den Wolken, so vermutete einst Reinhard Mey, müsste die Freiheit grenzenlos sein. Nun sind wir aber alle Erdenbürger und damit stellt sich die Frage: Bedeutet das zwangsläufig, dass es unterhalb der Wolkendecke gar keine (echte) Freiheit gibt? Und wenn das stimmt, was soll dann bitte das ganze Gerede von Individualisierung und Individualismus, von „jeder-kann-sich-heutzutage-nach-Belieben-selbstverwirklichen“?
Generation Selbstverwirklichung – oder?
Keine lapidaren Fragen, denn wenn sich unsere Generation auf eine Sache einigen kann, dann ist es wohl das Zugeständnis an die Individualität jedes einzelnen und an das damit verbundene Recht, seinen eigenen Vorstellungen zu folgen. Und zwar in jeder Lebenslage.
Das mag für den außenstehenden Betrachter schwer nachvollziehbar sein – der muss uns auch nicht immer verstehen –, aber letztendlich ist der Individualismus der gemeinsame Nenner, der die Generation Y, die Millenials oder wie immer die aktuell gängige Bezeichnung lautet, zusammenhält.
In gewisser Weise ironisch, dass ausgerechnet das Merkmal, das unsere jeweilige Einzigartigkeit feiern soll, noch am ehesten für einen Verallgemeinerungsversuch herhalten kann. Richtiggehend paradox und immer wieder gerne der Anlass für Spott, weil Individualismus oft genug dann doch wie Konformismus wirkt – was okay ist, denn in diesen Fällen haben wir uns bewusst dafür entschieden!).
Was wahrscheinlich auch der Grund für die Verständnisprobleme ist, denn wir sind nun einmal in uns selbst voller Gegensätze. Vermutlich, weil wir in eine paradoxe Lebenswelt hineingeboren werden.
 © babaroga – Fotolia.com
© babaroga – Fotolia.com Denn so sehr es den Anschein haben mag, dass wir für uns und unser Leben, unsere Biografie höchst selbst verantwortlich sind, so kann unser selbstgestalterisches Streben nicht ohne den größeren (sozialen) Zusammenhang gesehen werden. Individualismus mag Ich-bezogen sein, aber er funktioniert eben nicht ohne „die Anderen“. Wie könnte ich auch sonst meine Individualität definieren, wenn nicht über die Abgrenzung von anderen? Zu unterscheiden ist ein wichtiger, nein – elementarer Bestandteil, um das Selbst ausbilden zu können.
Das zeigt allerdings auch schon: Wer denkt, dass Individualismus mehr Freiheit bedeutet, muss schon bei der Ausgestaltung seiner eigenen Persönlichkeit die ersten Grenzziehungen feststellen. Selbstgezogene Grenzen wohlgemerkt, aber ohne ist die Selbstbestimmung nicht möglich. Immerhin: Da ich die Abgrenzung selber vornehmen kann, bleibt mir noch die Freiheit der Wahl.
Individualisierung als universelles Phänomen – oder: Die Qual der Wahl
Ist natürlich illusorisch, das zu glauben. Zumindest, wenn wir von einer uneingeschränkten Wahlfreiheit ausgehen würden. Die Wirtschaft zeichnet da verständlicherweise ein anderes Bild, nämlich das der universellen Individualisierung, die nahezu alle Lebensbereiche des Alltags bestimmt.
Ihr müsst ja nur einmal einkaufen gehen, um das zu überprüfen. Selbstverständlich ist das schier unendlich anmutende Angebot der Supermärkte auch der Globalisierung geschuldet, dem näher Zusammenrücken, das die Verfügbarkeit selbst von Waren aus den entferntesten Winkeln der Welt heutzutage zu einer leichten Übung werden lässt. Hauptsächlich reagieren die Hersteller mit ihren Produkten aber auf unseren Wunsch, selbst noch das Frühstück zu einem individualisierten Erlebnis werden zu lassen.
Das nehmen wir natürlich gerne an, sehen uns dadurch aber mit einer Vielzahl tagtäglich anfallender Entscheidungen konfrontiert. Das ist sozusagen die Kehrseite der Individualismus-Medaille. Wenn ich alles in meinem Leben, jedes Detail, von meinem beruflichen Werdegang bis hin zur Lieblingsmüslisorte, die ich jeden Morgen zum Frühstück esse, selbst und nach meinen Wünschen bestimmen kann – dann verpflichtet das zur Auswahl.
Es gibt sicher schlimmere Bürden und eine große Zahl von Menschen würde genauso sicher nur zu gerne tauchen, weil sie ein fremdbestimmtes Leben führen und kaum eine bis gar keine Wahlmöglichkeiten haben.
„Ich kann mich nicht entscheiden.“ war gestern – heute ist „Ich muss mich entscheiden.“
Das Paradox, um die Verpflichtung hinter der Freiheit zu wählen, sollten wir deswegen aber nicht als gering erachten. Die Notwendigkeit der Wahl kann durchaus zu einer Belastung werden, insbesondere deswegen, weil sie in einer individualisierten Gesellschaft permanent besteht. Damit sind jetzt nicht unbedingt solch epochale Entscheidungen wie die vor dem Müsliregal gemeint, um das Thema noch einmal aufzugreifen.
Derartige Entscheidungen sind in ihrer Tragweite und ihren Konsequenzen wirklich überschaubar. Im schlimmsten Fall werde ich in den nächsten zwei Wochen mit einem weniger erfüllenden Frühstück klarkommen müssen. Wenn ich Glück habe, trifft meine Auswahl den Geschmack von jemand anderem und das „Problem“ (das eigentlich gar keines ist) lässt sich durch eine gute Tat erledigen.
Wie sozial ist Individualismus noch?
Aber was ist mit lebensverändernden Entscheidungen? Die wirklich und wahrhaftig den weiteren Lebensweg bestimmen und bei denen ein „heute-hab-ich-da-keinen-Bock-drauf“ keine Option ist? Wenn es etwa um die Familie geht und die damit verbundene soziale Verantwortung? Es ist ja schließlich nicht so, als würde Individualisierung den Ausschluss aus der Gesellschaft bedeuten. Im Gegenteil. Wir sind immer noch soziale Wesen, daran kann alles Gerede von der Beziehungsunfähigkeit und Bindungsangst unserer Generation nichts ändern.
 © Jenny Sturm – Fotolia.com
© Jenny Sturm – Fotolia.comGeändert haben sich vielmehr die Umstände, unter denen unser Leben stattfindet. So gerne wir das nämlich glauben möchten, Individualisierung ist kein Phänomen, das alleine aus uns heraus entsteht. Es ist vielmehr in gesellschaftliche Strukturen eingebettet. Auch wenn das vielleicht nicht ganz der richtige Begriff ist.
Traditionelle Strukturen sind uns schließlich erst einmal suspekt und der Individualismus unserer Zeit zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, sich von diesen Mustern und Denkweisen zu lösen. Dass es aber gerade die Institutionen sind, von denen wir uns so gerne eingeengt fühlen in unserem Entfaltungswunsch (vom Bildungssystem etwa oder dem Staat), die diesen überhaupt erst ermöglichen – ein weiteres Paradoxon made by Generation Y.
Meine Individualisierung ist oft schon die Grenze der Individualisierung eines anderen
Wobei das so selbstverständlich nicht stimmt. Den Zusammenhang von Individualisierung und Sozialstrukturen (so sehr wir diese auch ablehnen mögen) zu leugnen, heißt nichts anderes, als auf einem rein ideologischen Ich-Begriff auszugehen. Wir sind aber nicht allein, nicht jeder für sich, und hier schließt sich der Kreis wieder: Individualisierung funktioniert eben nur im Miteinander (oder Gegeneinander, wenn man so will).
Meine Individualisierung zeigt einem anderen die Grenzen von dessen Individualisierung auf und umgekehrt. Obwohl die Intention eigentlich eine andere ist, sorgt die Individualisierung also geradewegs dafür, Grenzen zu erzeugen.
Sind wir deswegen weniger frei? Vermutlich nicht. Niemand von uns wird sich über mangelnde Möglichkeiten zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, seines Lebens beschweren können. Und wie traurig wäre es, wenn Individualismus bedeuten würde, am Ende alleine da zu stehen. Da erscheinen die Grenzen, wenn man sie als solche überhaupt wahrnehmen möchte, doch als sehr relative Einschränkung auf dem Weg zu uns selbst.