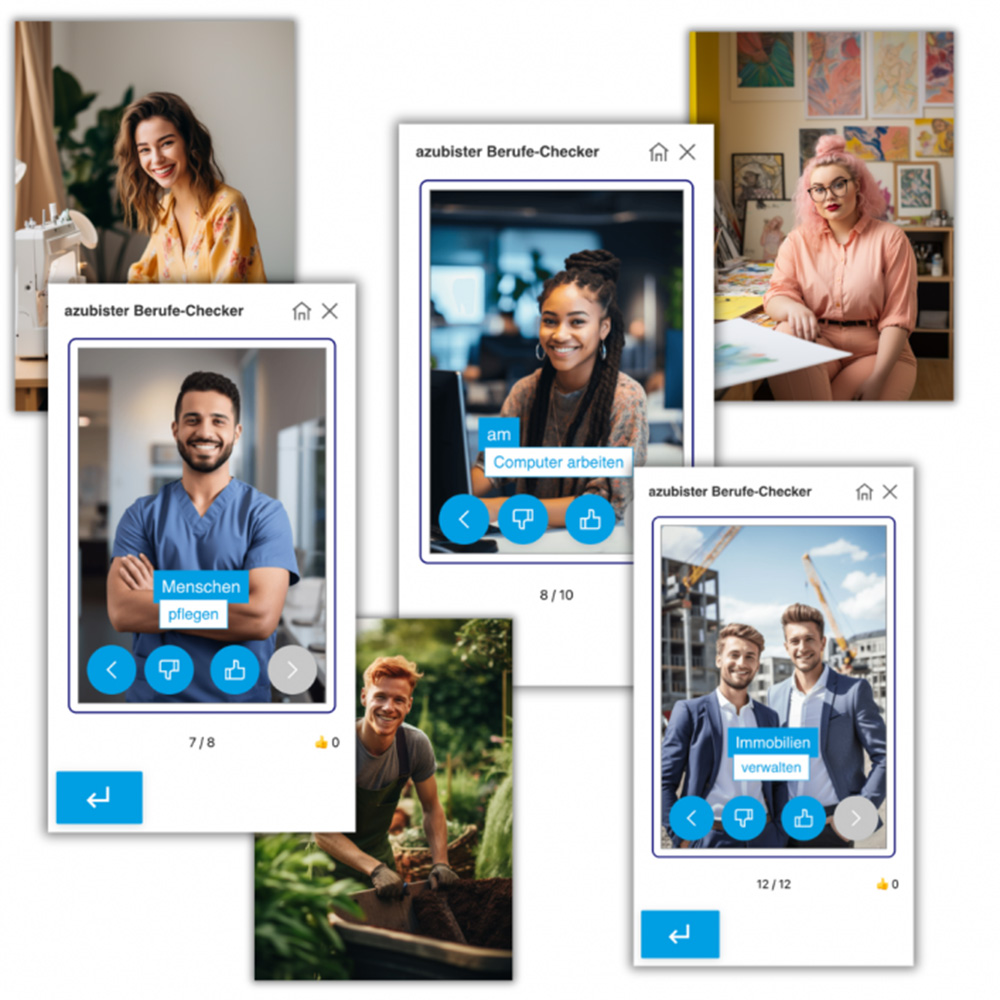Kommt dir folgendes Szenario bekannt vor? Kurz vor dem Wochenende ein letztes Meeting. Im Architekturbüro steht die Aufgabenverteilung für das nächste große Projekt an. „Wer macht die technische Planung?“, fragt der Chef. Er fixiert seine Mitarbeiterin, doch die junge Architektin schaut zögernd in die Runde: „Ich müsste mich erst mal reinarbeiten“. „Ich mach’s“, ruft schon ihr Kollege. Und weg ist das Projekt.
Eine fiktive Szene zwar, aber durchaus typisch. Denn Frauen fällt es im Job oft schwerer als Männern, sich zielstrebig zu positionieren. Zögerlich, unsicher, zu wenig fordernd zeigten sie sich in der Arbeitswelt, erklärt die Politologin Anja Bultemeier in einer aktuellen Studie über die Karrierechancen von Frauen. Denn Frauen sorgten sich eher darum, was die Kollegen von ihnen dächten – und blieben deshalb unter ihren Möglichkeiten. Das Ergebnis: Frauen arbeiten häufiger in schlecht bezahlten Berufen und seltener in Führungspositionen, insgesamt verdienen sie 22 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Sind Geschlechterunterschiede angeboren oder anerzogen?
Nach Jahrzehnten des Feminismus verhalten sich Frauen in vielen Lebensbereichen also noch immer geschlechtertypisch: eher beziehungsorientiert als autonom, eher angepasst als durchsetzungsstark. Woran liegt das?
Wissenschaftler streiten seit Jahrzehnten darüber, ob „nature“ oder „nurture“ verantwortlich sei, also die Natur oder die Umwelteinflüsse. Mittlerweile ist klar, dass Gründe vor allem in der Erziehung und wohl auch der Evolutionsbiologie zu finden sind.
Viele Eltern vermitteln ihren Kindern noch immer – unbewusst –stereotype Geschlechterrollen, etwa indem sie ihre Töchter anhalten, sich einfühlsam in andere hineinzuversetzen oder bei Schwierigkeiten Nähe und Unterstützung zu suchen. Die Söhne hingegen werden ermutigt, möglichst unabhängig zu sein, Probleme selbst zu klären und Dinge einfach auszuprobieren.
Das führt dazu, dass beiden Geschlechter unterschiedliche Fähigkeiten ausprägen: „Mädchen entwickeln ein ‚Beziehungsselbst‘ und Jungen ein ‚autonomes Selbst‘, erklärt die Psychologin und Buchautorin Ursula Nuber.
Männer und Frauen gehen mit Stress anders um
Doch nicht nur das: Die kalifornische Psychologieprofessorin Shelley Taylor analysierte tausende Studien zum Thema Stress sowohl unter Ratten als auch unter Menschen und fand heraus, dass weibliche und männliche Lebewesen in Belastungssituationen unterschiedliche biopsychologische Stressmuster zeigen.
Während die Männer bei Gefahr eher das Muster „fight or flight“ („kämpfen oder flüchten“) an den Tag legten, reagierten die Frauen überwiegend mit „tend and befriend“ („pflegen oder befreunden“). In gefahrvollen Situationen kümmerten sich Frauen und Rattenmütter also eher um ihre Kinder oder suchten Nähe zu Anderen.
Diese Beziehungsorientierung habe evolutionäre Wurzeln, vermutet Taylor: Obwohl die Hirnstrukturen von Frauen und Männer gleich sind, entwickelten sie im Laufe der letzten 120.000 Jahre entlang ihrer gesellschaftlichen Anforderungen unterschiedliche Ausprägungen. Demzufolge denken Frauen eher beziehungsorientiert und Männer eher (wett)kampforientiert.
Frauen müssen lernen, mehr an sich selbst zu denken
Das hat natürlich nicht nur Nachteile: Weil Frauen mehr Wert auf soziale Kontakte legen, führen sie engere Freundschaften und sind insgesamt weniger einsam als Männer. Außerdem holen sie sich schneller Hilfe und gehen häufiger zum Arzt, weisen also insgesamt ein besseres Gesundheitsverhalten als Männer auf.
Doch ihre Beziehungsorientierung beschert ihnen gleichzeitig einen ungesunden Dauerdruck: Im Job, in Partnerschaften, sogar in Freundschaften agieren sie aus der Angst heraus, abgelehnt zu werden. Und das bremst.
Dabei sind die Anderen meist gar nicht die strengen Übermütter oder Überväter, die wir aus ihnen machen: Unter Freunden und Kollegen gibt es viel Wohlwollen, auch Vorgesetzte sind meist angetan, wenn eine Mitarbeiterin auf eine gute Art fordernd und zielstrebig für ihre Entwicklungsmöglichkeiten eintritt.
Der Trick lautet also: Nicht an die anderen denken, an sich selbst denken. Einfach machen und sehen, was dann passiert. Frauen können sich von Männern in dieser Hinsicht eine Scheibe abschneiden.
Geschlechterrollen ade: Wir können sein, wie wir wollen
Doch natürlich finden sich auch unter Frauen viele gute Vorbilder. Letztendlich sind wir nämlich alle grundverschieden, jeder Mensch bringt eine individuelle Mischung aus vermeintlich weiblichen und männlichen Charakterzügen mit.
Niemand würde auf die Idee kommen, Angela Merkel als gefühlsbetont zu bezeichnen oder Nachrichtenmoderator Claus Kleber, den die Flüchtlingsproblematik im Fernsehen jüngst zu Tränen rührte, als beinharten Macker. Und genau darin steckt die richtig gute Botschaft: Gesellschaftlichen Stereotypen müssen wir uns nicht beugen, wir können sie verändern. Jeden Tag. Ob wir dann eher männlich oder weiblich auftreten, ist völlig egal – der Weg zum Glück führt über die persönliche Freiheit, so sein zu können, wie wir wollen.