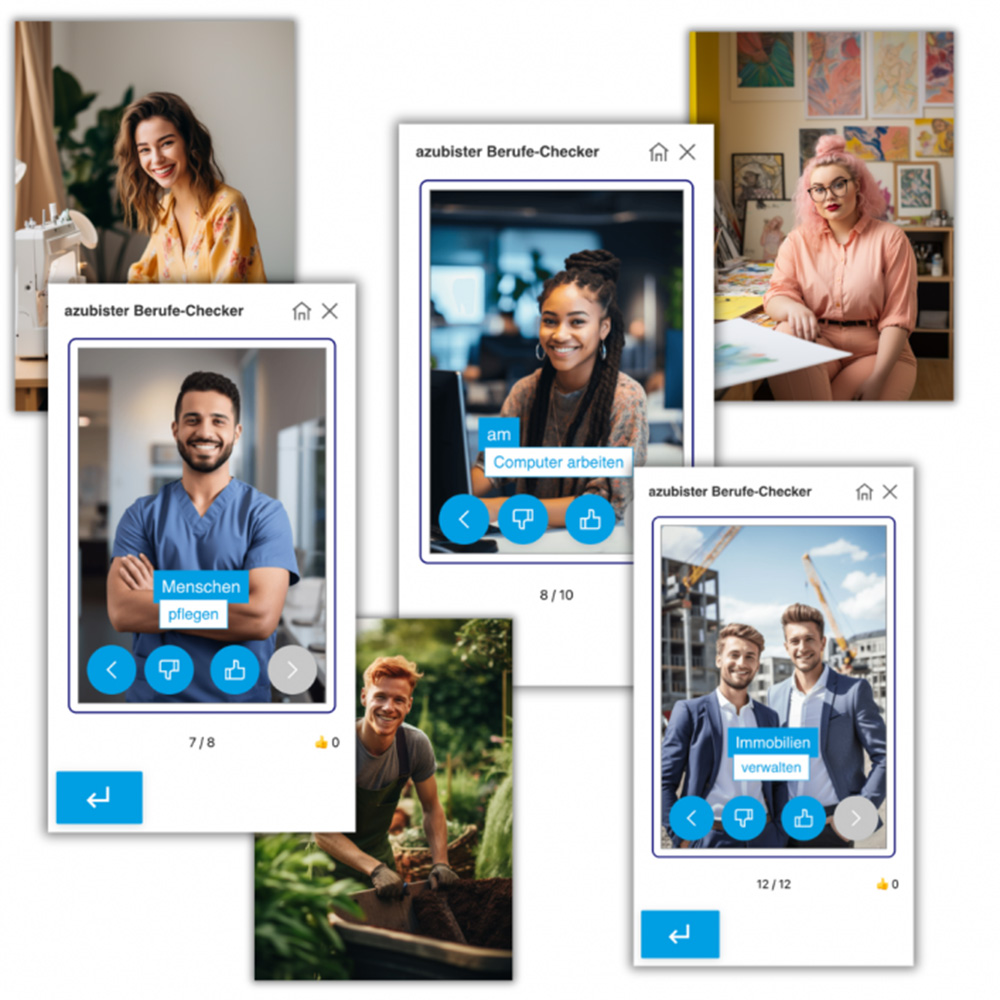Ist Scheitern das Gegenteil von Erfolg? Werden wir durch ein Scheitern im Beruf automatisch unglücklich? Oder können wir vielmehr eine Lehre daraus ziehen, frei nach dem Motto: Nicht das Fallen ist das Scheitern, sondern das Liegenbleiben? Life-Coach Markus Drewes hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.
Hat Arbeit etwas mit dem persönlichen Glück zu tun? Es gibt nur wenige, die hier ernsthaft „Nein“ sagen würden. Arbeit als sinnhaftes, schöpferisches und wertschaffendes Handeln bringt Anerkennung, Einkommen und Zufriedenheit. Wie jedoch hängen Arbeit und Beruf zusammen?
Mit der Definition von Beruf als „dauerhaft gegen Entgelt ausgeübte spezialisierte Betätigung eines Menschen“ (Wikipedia). Für manche Menschen haben Beruf und Arbeit offensichtlich wenig miteinander zu tun.
Auch „Erfolg im Beruf“ hat für verschiedene Menschen ganz unterschiedliche Bedeutungen, das wurde im ersten Teil bereits festgestellt: Die einen meinen eine Tätigkeit, die sie glücklich macht. Die nächsten eine, bei der sie sich selbst verwirklichen können. Und noch andere eine, die einfach nur genug Geld einbringt, damit man im Rest der Zeit tun und lassen kann, was man möchte. Wieder andere messen ihren Erfolg in Geld und Macht. Und ganz andere meinen einen Zustand, in dem sie möglichst ungestört vor sich hin wursteln können.
Die Botschaften des Erfolgs oder Scheiterns
Wenn man so will, sagt Erfolg also nicht mehr und nicht weniger als: „So geht es.“ Und meint damit, dass der eingeschlagene Weg oder das eingesetzte Mittel zum Ziel geführt hat. Eine positive Rückmeldung auf irgendwelche Maßnahmen. Im Umkehrschluss sagt ein Scheitern: „So geht es nicht.“ Nicht mehr und nicht weniger.
Mit anderen Worten, ein Feedback, das sagt: „Mach es anders.“ In diesem Sinne ist ein Scheitern an sich also kein Problem – vielleicht sogar gar kein „Scheitern“? –, wenn daraus eine Lernerfahrung gezogen wird.
Aus Fehler kann man lernen, anstatt an ihnen zu verzagen
Eine Lernerfahrung aus der Rückmeldung „So nicht“ ziehen zu können, das ist die eine Seite der Medaille. Eine Lernerfahrung daraus ziehen zu dürfen, das ist die andere Seite. Dazu braucht es auch Unternehmen, bei denen ein produktiver Umgang mit Fehlern gewünscht und möglich ist.
Ein plakatives und oft zitiertes Beispiel für eine konstruktive Fehlerkultur ist das von IBM, wo ein Mitarbeiter einen millionenschweren Fehler in der Produktentwicklung machte. Watson jr., der damalige Konzernchef, zitierte ihn zum Gespräch und fragte gegen Ende:
„Was glauben Sie passiert jetzt?“
„Nun ja“, antwortete der Unglücksrabe, „Sie werden mich entlassen. Ich habe einen Fehler gemacht, der unsere Firma 10 Millionen Dollar gekostet hat.“
Zu seiner Überraschung antwortete der Konzernchef jedoch: „Warum sollte ich Sie entlassen? Ich habe doch gerade 10 Millionen Dollar in Ihre Ausbildung investiert.”
In Deutschland war der Umgang mit Fehlern lange Zeit viel verbissener, ist es in manchen Unternehmen heute noch. Im Extremfall wurden Menschen, die Fehler gemacht hatten – man könnte sie „Gescheiterte“ nennen – stigmatisiert oder gar ausgeschlossen. Und während es für den Erfolg verschiedene Grade gibt – „Achtungserfolg“, „Teilerfolg“, „Scheinerfolg“, um nur ein paar zu nennen – gibt es beim Scheitern scheinbar nur das endgültige.
Eine Frage der Perspektive: Halbvoll oder halbleer?
Wenn Erfolg „das Erreichen eines definierten oder allgemein als erstrebenswert anerkannten Ziels“ (Wikipedia) ist, dann wäre das absolute Gegenteil – man könnte es „Scheitern“ nennen – nicht angenehm. Allerdings sagt der Begriff „Scheitern“ erst einmal nichts darüber aus, zu wie viel Prozent man das Ziel erreicht hatte. Oder darüber, wie realistisch das Erreichen des Ziels war.
Oder darüber, zu einem wie großen Teil man überhaupt selbst zum Erreichen des Ziels beitragen konnte. Dabei spielen doch gerade diese beiden letztgenannten Punkte eine wichtige Rolle in den so genannten „Wohlgeformtheits-Kriterien“ für Ziele. Und der Begriff „Scheitern“ sagt schon überhaupt gar nichts über die Lernerfahrung aus, die der Betroffene aus dem Fehler gewonnen hat.
Falls man also wirklich das große Wort „Scheitern“ – mit seinem Anklang von „ewiger Verdammnis“ – für sich selbst in Anspruch nehmen möchte, sollte man genau prüfen, ob es für den konkreten Fall auch wirklich zutreffend, angebracht und geeignet ist. Und dann sollte man abschließend noch prüfen, ob es einem gut tut, es so zu nennen.
Nach dem Scheitern wieder aufstehen und weitermachen
Forrest Gump sagt: „Dumm ist, wer Dummes tut.“ Damit wird der Wert einer Handlung an ihren Konsequenzen gemessen. Ähnliches gilt für „Scheitern“: Wirklich gescheitert ist nur, wer im Scheitern verharrt. Wer aus Fehlschlägen und Misserfolgen lernt und sich entwickelt, kann gar nicht scheitern. Auch nicht im Beruf.
Es gibt immer andere Aufgaben, andere Projekte, andere Jobs, andere Arbeitgeber und im Ernstfall auch andere Berufe, aus denen man auswählen kann, falls es aktuell nicht zufriedenstellend laufen sollte. Denn manchmal bedeutet Entwicklung auch, dass man einen Weg verlassen muss, der lange Zeit gut und richtig war. Ganz nach dem Motto: „Das Ziel erreicht man auch nicht eher, wenn man schneller in die falsche Richtung läuft.“
Aber was ist, wenn jetzt ernsthaft mal jemand meint, er sei im Berufsleben gescheitert? Und sei es nur vorübergehend? Das jedenfalls wäre eine wesentliche Einschränkung der Lebensqualität. Denn Arbeit (Leistung, Beruf) ist einer der zentralen Bereiche des menschlichen Lebens. Je nach Intensität kann professionelle Begleitung durch einen Therapeuten oder durch einen Coach sinnvoll sein.